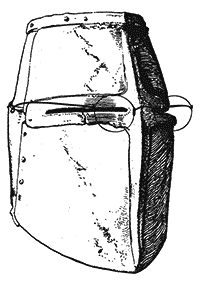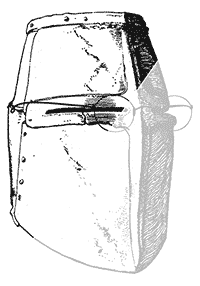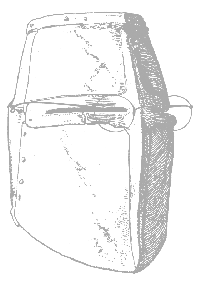Querverweis VI: Netz / Druck / Geld
In Anlehnung an einen früheren Querverweis, muss man neben dem Vergleich Nachrichtenwert / kommerziellen Wert des Mediums, auch über die Art des Mediums nachdenken: Holz oder Mikrochip ist gegenwärtig die große Frage und wenn Mikrochip, wie Geld?
Zahlreiche große deutsche Zeitungen (Die Zeit, Spiegel, FAZ, SZ, etc.) haben in den vergangenen Monaten ihre iPad-Ausgabe auf den Markt gebracht um sich der Vorteile optisch ansprechender, leicht bedienbarer Konsumententechnologie zu bedienen. Zwei Chefredakteure großer amerikanischer Magazine bleiben hingegen skeptisch.
Der Chefredakteur des Harper’s Magazine John R. MacArthur glaubt, dass sich Zeitschriftenverleger ihre Produkte in den pyroklastischen Strömen des Netzes nicht einschmelzen lassen dürfen. Der harte Wert der Anzeigenplatzes sei auf Papier immer noch am einträglichsten, so MacArthur in seinem Essay in der Providence Journal:
„Was ich als Verleger gelernt habe, glaube ich noch an den ‚Unvermeidbarkeits-Faktor‘. Kommerzielle Zeitungen und Zeitschriften sind de facto Kataloge mit Artikeln drumherum gewickelt. Sie sind erheblich effektiver eine Werbebotschaft zu liefern, da man auf Papier nicht die Anzeigen vermeiden kann, wenn man die Artikel dazwischen ließt.
Außerhalb physischer Reichweite, sind sie aus dem Sinn. Irgendwann schaltet man den Computer und das iPad aus, aber die Broschüren und Druckwerke landen weiter im Briefkasten.
Anzeigen im Netz sind viel zu einfach zu vermeiden. Solange die Tea Party oder die Demokraten das U. S. Post Office nicht sterben lassen, würde ich nicht gegen Print wetten.“
MacArthur verweist in seinem Text auf ein Interview mit dem Rolling Stone-Chef Jann Wenner, der mit der Kampagne The Power of Print das ökonomische Selbstbewusstsein der Magazinbranche stärken will. In einem Interview mit dem Branchenblatt amerikanischer Werbeindustrie Advertising Age schlägt er einen eher sorglosen Ton gegenüber der Digitalisierung gedruckter Medien an:
„Ich glaube nicht, dass man viele Vorteile als Magazinleser hat, wenn man es auf dem Tablet liest. Es ist komplizierter ein E-Paper zu lesen als eine Zeitschrift aufzuschlagen.
Aus Sicht eines Verlegers halte ich es für verrückt, andere Herausgeber dazu zu ermutigen ein E-Papier zu etablieren. Man bekommt weniger Anzeigenerlöse. Es kostet viel um ein E-Paper marktreif werden zu lassen. Außerdem verkaufen sie sich nicht. Man wird die Entwicklungskosten nicht decken können.
Sterbende Lokalzeitungen und die Prekarisierung des Journalisten als Nebeneffekte – das verneinen auch beide Schwergewichte amerikanischer Presse nicht – sind von diesen entspannten Aussichten ausgeschlossen.
Der Guardian geht in die ganz andere Richtung und treibt seinen Netzauftritt konsequent voran. Das englische Zeitungshaus lud letzte Woche zum Guardian Open Weekend mit 196 Diskussionen, Vorträgen und Workshops, die sich vor allem auch um den Erhalt der hochqualitativen, aber trotzdem immer umsatzschwächeren Zeitung drehten. Auch bei der britischen Qualitätszeitung weiß man nicht so recht wie man mit dem Internetauftritt ordentliches Geld verdient, wie Mercedes Bunz in der Süddeutschen Zeitung schreibt:
„Im Netz ist die Bindung an publizistische Marken schwach. Die Leser bleiben zu kurz und lesen zu wenig. Der Guardian hat deshalb begonnen, die Flut an Leserkommentare in eine Konversation mit dem Leser zu verwandeln. Auch aus finanziellen Gründen: (Guardian Chefredakteur) Rusbridger hofft, an die Stelle einer Paywall eine bezahlte Mitgliedschaft setzen zu können.“
Sowohl Interview, als auch Essay wecken übrigens an dieser Stelle ernste Überlegungen des Blog-Schreibens und wie man in Zukunft den Leser finanziert, die eingesetzte Freizeit entgelten lässt und die Magazine und Abonnements bezahlt. Sehr gerne mit einmaligen Zahlungen der Dauergäste. Irgendwann.